»Guten Morgen«, knurrte Onkel Gerd, hämmerte auf den Blecheimer mit Grafschafter Goldsaft ein, bis der Rübensirup gegen den Küchenschrank spritzte, und befahl:
»Ablecken!«
»Guten Morgen«, knurrte Onkel Gerd, hämmerte auf den Blecheimer mit Grafschafter Goldsaft ein, bis der Rübensirup gegen den Küchenschrank spritzte, und befahl:
»Ablecken!«
Seit nunmehr einhundertfünfundzwanzig Jahren sitzt der Schachweltmeister Wilhelm Steinitz in seinem Schmollwinkel und ist böse auf Gott, weil der sich trotz des großzügigen Angebots, ihm einen Zug und einen Bauern vorzugeben, standhaft weigert, auch nur eine einzige Partie gegen den Erfinder der Telefonie ohne Drähte und Apparate zu spielen, und lieber den Schuhmachergesellen und Hochstapler Friedrich Wilhelm Voigt beim Offiziersskat ein ums andere Mal über den Tisch zieht.
Wie eine Runkelrübe,
die aufs Pflaster schlägt,
zerplatzt der Traum,
wenn der Wecker schrillt.
Eines Nachmittags vor 52 Jahren stand plötzlich ein nagelneues schneeweißes Toilettenbecken mitten in unserer Küche und ein halbes Dutzend junger Menschen darum herum. Unsere Küche war wunderbar groß und diente uns damals besonders an den Wochenenden als eine Art Jugendzentrum und Ausgangspunkt unserer politischen und sonstigen Unternehmungen. Schaumi und Otto hatten das Toilettenbecken an einer Baustelle entdeckt und in einem günstigen Augenblick mitgehen lassen. Sie wußten auch schon, was wir damit anstellen sollten, eine Serie von Toilettenfilmen drehen nämlich: das Toilettenbecken als Waschschüssel, als Bowlengefäß, als Blumenvase, als Suppenterrine beim Heiligen Abendmahl, als Schale, in der das olympische Feuer entzündet wurde, es waren ja gerade olympische Spiele in München, insgesamt neun Episoden fielen uns ein.
Mit irgendwelchen Planungen oder detaillierten Festlegungen hielten wir uns damals nie lange auf, sondern schritten lieber sofort zur Tat. Ich packte meine Kamera ein, eine veraltete Eumig Normal-8 mit einem hellblauen lederartigen Kunststoffbezug, die man noch aufziehen mußte, damit sich der eingelegte Film drehte. Die hatte ich für weniger als fünfzig Mark gebraucht bei einem Fotohändler in Bückeburg gekauft. Auf dem Weg in die Feldmark besorgten wir, was wir sonst noch für die Außenaufnahmen brauchten: Rucksackriemen, eine Fackel und eine Flasche Brennspiritus nebst drei Komparsen, die uns zufällig über den Weg liefen.
Für die Wandertoilettenepisode schnallte sich Schaumi das Becken wie einen Rucksack auf den Rücken, lief ungefähr zwanzig Meter im Wanderschritt über einen Acker, hielt an, schnallte das Toilettenbecken ab, zog die Hosen herunter, setzte sich eine Weile auf das Becken, stand wieder auf, zog die Hosen wieder hoch, schnallte sich das Becken wieder um und lief weiter. Wirklich zu scheißen wagte er nicht, weil wir Toilettenpapier und Wasser zum Spülen vergessen hatten.
Weiter ging es in dem kleinen Wäldchen auf der anderen Seite der Bahn. Manni I. mußte zuerst in seinem Fußballtrikot mit der brennenden Fackel in der Hand auf einen Trampelpfad einen kleinen Hügel hinunterlaufen, links und rechts flankiert von unseren Komparsen als begeistertes Publikum, in mehreren Einstellungen immer dieselben Komparsen, aber an anderen Stellen. Schließlich schafften wir das Toilettenbecken auf den Gipfel des Hügels und schütteten eine ordentliche Ladung Brennspiritus hinein. Manni mußte jetzt, wieder von den Komparsen flankiert, den Weg hochlaufen, und wurde dabei von mir von hinten gefilmt. Oben angekommen, stellte er sich rechts neben die Toilette und senkte die Fackel langsam hinein. Die Flamme loderte wirklich schön empor und war hinterher auch gut auf dem entwickelten Film zu sehen.
Leider hielt das Porzellanbecken die Hitzeentwicklung nicht aus und zersprang. Das Toilettenfilmprojekt lag in großen Scherben und wir hatten noch das Glück, keinen Waldbrand entfacht zu haben. Schade. Es war eine so schöne Idee.
die worte verschlingen
den spiritus ausspucken
den verstand wiederkäuen
Immer ist irgendwo auf der Welt Nacht, anderswo geht jemand hinaus, die Welt zu retten, und ein anderer kommt sturztrunken davon nach Hause.
1
Das Gute, Wahre, Schöne,
wo ist es geblieben?
Im Fett, das aus der Bratwurst trieft?
Oder in der Hundescheiße unter meinem Schuh?
2
Von der Bratwurst tropft das Fett auf die Hose. Werner rülpst. Durch seine leicht geöffneten Lippen sprüht er etwas Brät zurück in die Welt.
»Zur Linde«, »Weserfähre«, 800 Meter weiter »Sandkrug«, »Zur Post« und »Ochsentränke«: wirtschaftsmäßig konnte man früher bei uns im Dorf noch was lernen.
Es kam, wie es kommen mußte. Kirchmanns Erich wurde seiner Frau von Tag zu Tag ähnlicher. Bis er sich eines Nachts mit ihr verwechselte und im Schlaf über sich herfiel.
Sandkrug
Bis Anfang der 60er Jahre gab es im Saal des Sandkrugs in Estorf noch einmal in der Woche Kino, mittwochs oder samstags, ich erinnere mich nicht mehr genau. Der erste Film, den ich dort gesehen habe, war aber eine Dokumentation über die deutsche Springreiterei, kurz nach den Olympischen Spielen 1960 an einem Nachmittag von Fritz Thiedemann, Gold mit der Mannschaft, persönlich präsentiert. Der erste Spielfilm meines Lebens, der einzige bei Meyers Karl auf dem Saal, war »Unternehmen Petticoat« mit Cary Grant und Tony Curtis.
Schauburg
Wenn mein Vater gute Laune hatte, war Anfang der 1960er der Sonntag ein Kinotag, dann fuhr er meinen Bruder und mich mit seinem Moped, NSU-Weltmeister, rot, die sechs Kilometer von Leeseringen bis zur Schauburg in Nienburg, erst meinen Bruder auf dem Sozius ein Stück, während ich zu Fuß gehen mußte, dann setzte er ihn ab und er mußte gehen, wendete, holte mich, setzte mich wieder ab, wenn wir meinen Bruder erreicht hatten, immer vier, fünf Etappen, bis wir die Schauburg erreicht hatten. Mein Bruder und ich gingen in die Nachmittagsvorstellung, Hollywood-Western und Abenteuerfilme, an »Taras Bulba« erinnere ich mich noch genau, weil neben mir ein fies grinsender Jugendlicher saß, eklige Frisur, Nackenglatze, das Haupthaar hing strähnig darüber wie bei Riff Raff, nur kürzer, aber auch an »Ben Hur« wegen einiger Szenen, die mich bis heute beeindrucken, mein Vater fuhr dann sofort zurück in eine ungestörte Elternzeit, und holte uns auch wieder ab.
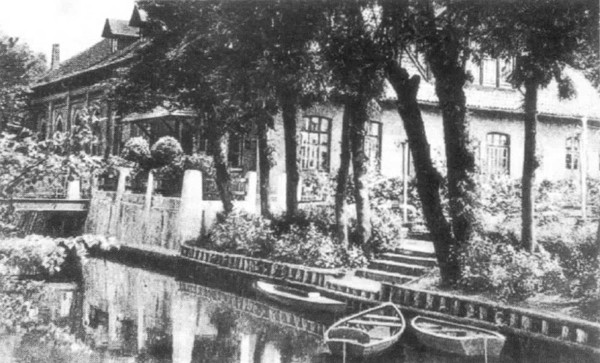
1967 und 1968 verstaubte die Weltmeister im auch nicht mehr genutzten Schweinekoben, die Hollywoodschinken interessierten mich weniger, Hans-Georg Moré hatte die Schauburg gepachtet und die Gaststätte im Gebäude in eine Diskothek verwandelt, meine Sonntagnachmittage verbrachte ich jetzt dort, der Samstagabend war anderen Orten vorbehalten, Schlaghosen mit Umschlag in Fischgrät, mein Tanz wurde zur Balz, wenn ich mich hintüber beugte, konnte ich meine Schultern wenige Zentimeter über dem Boden schweben lassen und meinen gefürchteten 30-Sekunden-Schrei – handgestoppt – ausstoßen, als mir dann jemand dabei einen Packen Bierdeckel in den Mund stopfte, um mich zum Schweigen zu bringen, ließ ich es doch lieber wieder.
Diskjockey war Günter Messe, bekannt geworden durch einen mißlungenen Versuch, am zweiten Tag abgebrochen, für das Guinness-Buch den Weltrekord im Plattenauflegen zu brechen, seine Karriere war dahin, später sah ich ihn dann noch einmal, im AKI im Hauptbahnhof Hannover an der Kasse, wie ein abgelebter ausgebleichter Zuhälter mit seiner Blondmähne. Manchmal traten auch ausrangierte Hitparaden-Bands auf, die Equals vor gezählten fünf Zuschauern, im Kino konnte man rauchen und trinken, »Die linke und die rechte Hand des Teufels« und »Spiel mir das Lied vom Tod« in Kneipenatmosphäre.
Die Diskothek lief nicht mehr so recht, der gelernte Koch Moré verwandelte sie 1971 in das erste China-Restaurant der Stadt, Ente süß-sauer und Chop Suey wurden auch während der Vorstellungen im Kino serviert, nichts für mich, diese Kombination, sie brachte wohl auch nicht den gewünschten geschäftlichen Erfolg, denn nach der Spätvorstellung eilte Hans-Georg Moré mit seiner Frau in die Bodega-Bar, um dort als »Karin & Georg« eine Sex-Live-Show abzuliefern. 1974 gelangte das Grundstück in den Besitz der Stadt, die es an das Deutsche Rote Kreuz verschenkte, damit dort ein Altenheim gebaut wurde. Moré sammelte mehr als 7000 Unterschriften für den Erhalt dieser Kulturstätte, die 150 Jahre als Theater und Kino gedient hatte, vergeblich, am 1. Februar 1977 wurde das Gebäude abgerissen.

Lichtspiele
Die Lichtspiele in der Langen Straße 55, zwischen der Spielwarenhandlung Twele und dem Kaufhaus Jensen, wenn ich mich recht entsinne, waren das älteste Kino Nienburgs und bestanden von 1912 bis 1968. Antonionis »Die drei Gesichter einer Frau« mit der Ex-Kaiserin Soraya als Hauptdarstellerin, Teshigaharas »Die Frau in den Dünen« und Jess Francos »Nachts, wenn Dracula erwacht« mit Christopher Lee als Dracula und Klaus Kinski als Renfield habe ich dort gesehen, als im letzteren Film kurz vor Schluß Harker und Morris die drei weiblichen Vampire pfählen, erschien mir das so lächerlich, daß ich laut loslachte, das gesamte Kino, 200 Plätze, nur zu einem Drittel besetzt in der Nachmittagsvorstellung, lachte mit, der Grusel war aufgehoben.

Film-Eck
Nienburgs größtes Kino, jetzt ein »Kino-Center« mit drei Kinos, Karl-May-Filme, James Bond, später in den 1980ern dann jedes Jahr im Sommer »Blues Brothers« in einer Spätvorstellung in Kino 3, in diesem Kino 3 lief auch der einzige Film, aus dem ich wieder rausgelaufen bin, Tinto Brass‘ Caligula, Peter Etzold als Althistoriker hatte mich hineingelockt, aber nach ungefähr einer Viertelstunde, die Sex-Szene mit dem Hengst, kamen wir überein, uns diesen »ahistorischen Kolportage-Scheiß« nicht länger anzutun.

Noli (Nordertor-Lichtspiele)
Das jüngste und kurzlebigste Kino in Nienburg: ein halbwegs spannender und lustiger Fuzzy-Film an einem Sonntagnachmittag, »Zur Sache, Schätzchen«, »Nicht fummeln, Liebling« und, zweimal, weil so beeindruckend, Polanskis »Rosemaries Baby«, den Roman von Ira Levin gleich hinterher.
Birke (Minden)

In der Zeit in der Jägerkaserne in Bückeburg sind wir manchmal nach Minden ins Kino gefahren. H. W. Geißendörfers Jonathan in der Birke war eines meiner beeindruckendsten Kinoerlebnisse, vor allem die Kamera, Bilder, die umhauen, elfengleiche böse Wesen umtanzen eine an einen Baum gefesselte Frau und schlagen sie aus der Bewegung heraus sonderbar elegant mit kurzen Stricken (?), bei der Schlußszene am Meer erhoben wir uns aus den Sitzen und genossen die Bilder im Stehen.
Einmal wollten wir auch in das andere Kino in der Fußgängerzone, »Flucht in Ketten«, doch wir schafften es nicht pünktlich, außer uns hatte niemand den Weg in diesen Klassiker gefunden, sie wollten schon zusperren, verkauften uns aber noch vier Karten, warfen den Projektor wieder an und zeigten uns nur den Hauptfilm.
Apollo (Hannover-Linden)
Donnerstag, 1. Februar 1973, in der Halle 52 bei Telefunken in Empelde, jemand hatte eine Hannoversche Allgemeine mitgebracht und ich griff mir in der Frühstückspause die Seiten mit den Kinoanzeigen. Zu meiner Verblüffung zeigte das Apollo in Linden zur Abwechslung keinen Sexfilm, sondern Stanley Kubricks »2001: Odyssee im Weltraum«. Da mußte ich rein. Was ich erst später erfuhr: Mit diesem Tag hatte Henk ter Horst, der Besitzer des Apollo, die Programmgestaltung in Hände des Studenten und Filmliebhabers Achim Flebbe gelegt und der verwandelte das Apollo in eines der ersten Programmkinos Deutschlands.
Ich sollte noch oft hingehen, erinnere mich aber kaum noch an einzelne Filme, an einen aber umso besser, an Polanskis »Macbeth«, eine absurde Vorstellung, der Vorführer war betrunken und zeigte die Rollen in falscher Reihenfolge, Heiterkeit und fröhlicher Applaus, das Publikum wurde in die Kneipe nach nebenan geschickt, nach einer halben Stunde ging es mit einem neuen Vorführer weiter, weiter Gejohle und Pfiffe, kaum jemand konnte den Film mehr als Tragödie anschauen, ich bis heute nicht.

Filme außerhalb des Sex- und Klamaukschrotts konnte man in meiner hannoverschen Zeit (1973 – 1974) noch im Kino im Anzeiger-Hochhaus (man mußte mit dem Fahrstuhl mehrere Stockwerke hoch) sehen. Luis Buñuels »Der diskrete Charme der Bourgeoisie«, Bertoluccis »Der letzte Tango in Paris«, Ferreris »Das große Fressen«, Louis Malles »Herzflimmern« (da saßen der niedersächsische Kultusminister Peter von Oertzen und seine Frau direkt hinter mir).
Manchmal hatte ich in dieser hannoverschen Zeit so große Lust auf Kino, daß ich einen Tag Urlaub nahm oder mich krank meldete, um an diesem Tag so viele Filme wie irgend möglich zu sehen, mein Rekord waren fünf Filme hintereinander, angefangen mit einer Vormittagsvorstellung in einem Kino am Steintor, »Sie nannten ihn Plattfuß« mit Bud Spencer, abgeschlossen mit der Spätvorstellung im Gloria-Center in der Georgstraße 52, Peter Bogdanovichs »Die letzte Vorstellung«, sehr passend und bis heute einer meiner Lieblingsfilme.
AKI Frankfurt
Eines der aufregendsten Wochenenden meines Lebens. Als popeliger Schülerzeitungsredakteur unterwegs zu einem Juso-Journalistenkongreß in Frankfurt mit lauter Profis, vorher aber Kurzbesuch beim Schriftsteller Hans Frick, vermittelt durch Bettina George, bei der ich damals Schultheater spielte, als Lektüre mitgegeben einen Vorabdruck seines neiuen Romans »Henri«, so etwas deftig Direktes hatte ich noch nicht gelesen, Durchstechen der Hoden mit einer heißen Stricknadel zwecks allerletzten Lustgewinns, auf dem Kongreß, man müsse »vorsichtig« agieren, beschlossen wurde die »kalte Enteignung« der Verlegerkapitalisten durch die Hintertür, ein Rhetorikfurz, wußte ich aber damals noch nicht, fühlte mich nur großartig in dieser Gesellschaft, besonders, als mich Norbert Gansel und Karsten Voigt, stellvertrender und Bundesvorsitzender, in dessen Daimler zum Bahnhof kutschierten.
Jedenfalls hatte deshalb ich noch viel Zeit, bis mein Zug fuhr, im AKI am Bahnhof lief Polanskis »Tanz der Vampire«, ich ging hinein, die Szene, in der Ferdy Mayne als Graf von Krolock auf dem steinern Balkon nur ganz kurz die Vampirzähne fletscht und sich dann wieder im Griff hat, gefiel mir so gut, daß ich für weitere zwei Vorstellungen sitzen blieb und in dieser Zeit drei Züge verpaßte: nur für diese ein Szene.